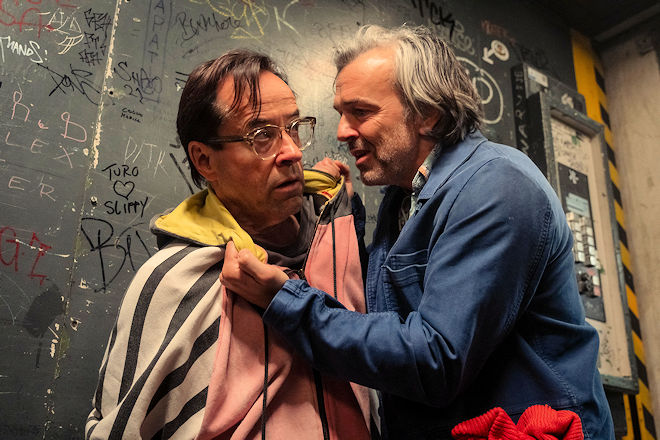Demenz verstehen, bevor sie dich vergisst: Hirschhausen auf Spurensuche im eigenen Kopf - heute (03.11.2025) in der ARD
Mit einer Thematik von tiefgreifender persönlicher und gesellschaftlicher Relevanz startet die ARD heute Abend (03.11.2025) in den Primetime-Abend: Um 20:15 Uhr läuft der erste Teil von "Hirschhausen und das große Vergessen - Habe ich Demenz?". Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen begibt sich in dieser zweiteiligen Dokumentation auf eine Spurensuche, die Millionen Menschen in Deutschland betrifft - entweder direkt als Betroffene, als sorgende Angehörige oder aus der tief sitzenden Angst heraus, selbst einmal zu erkranken. "Hirschhausen und das große Vergessen" ist auch über die ARD Mediathek abrufbar.
Die Angst vor dem Vergessen: Eine sehr persönliche Spurensuche
Der Arzt und Wissenschaftsjournalist nähert sich der Krankheit Demenz, mit der hierzulande etwa 1,8 Millionen Menschen leben, auf eine besonders ehrliche und persönliche Weise. Auch in seiner eigenen Familie gab es Demenzerkrankungen, und er selbst beschäftigt sich mit der Sorge, betroffen sein zu können. Das macht die Dokumentation mehr als nur eine medizinische Recherche. Hirschhausen verdeutlicht die Dringlichkeit der Thematik: "Jeder von uns hat früher oder später mit Demenz zu tun und Angst, selbst einmal zu erkranken. Deshalb zeige ich, wie es in meinem Kopf aktuell aussieht."
Die Dokumentation beleuchtet umfassend, was Demenz überhaupt ist, welche Gesichter die verschiedenen Formen der Krankheit haben und was im Gehirn dabei geschieht. Sie stellt die Krankheit als eine der größten medizinischen und sozialen Herausforderungen unserer zunehmend überalterten Gesellschaft dar.
Prävention beginnt im mittleren Alter
Ein zentraler und optimistischer Aspekt der Recherche ist die Prävention. Während Demenz lange Zeit als unabwendbares Schicksal des Alters galt, zeigen führende Forschende heute, dass fast die Hälfte der Demenzerkrankungen verhinderbar sein könnte. Die entscheidende Botschaft: Demenz beginnt nicht erst im hohen Alter, sondern die Prozesse setzen spätestens im mittleren Lebensalter ein. Je früher man mit präventiven Maßnahmen beginnt, desto höher die Chance, den Verlauf positiv zu beeinflussen.
Hirschhausen testet die Forschungsergebnisse an sich selbst: Er lässt sich im Deutschen Zentrum für neurogenerative Erkrankungen (DZNE) in Bonn umfassend untersuchen. Dabei wird aufgezeigt, wie eng Schlaf, pflanzenbasierte Ernährung, Bewegung und lebenslange Neugier mit der Hirngesundheit zusammenhängen. Er trifft im Rahmen der "Super-Ager-Studie" an der Uni Magdeburg den 90-jährigen Willy B., der sich mit einem selbst entwickelten Fitness-Programm fit hält und geistig topfit ist. Die Begegnung bewegt Hirschhausen nachhaltig: "Der beste Weg, seine grauen Zellen frisch zu erhalten, ist ein buntes Leben! Ich möchte auch einmal Super-Ager werden."
Leben mit der Krankheit: Die Rolle der Liebe und Akzeptanz
Neben der Prävention rückt die Dokumentation die Situation der Betroffenen und ihrer Angehörigen in den Mittelpunkt. Hirschhausen zeigt, wie es gelingen kann, ein gutes Leben mit Demenz zu führen. Er trifft die 25-jährige Studentin Laura, die ihre an Demenz erkrankte Mutter in ihrer WG pflegt und sie in ihrer jetzigen Form akzeptiert, sowie Jutta, die ihren Mann Georg seit zwölf Jahren zu Hause pflegt. Jutta fasst es emotional zusammen: "Die Gefühle bleiben bis zuletzt ... Wir haben es eigentlich ganz gut hingekriegt."
Die Dokumentation zeigt auch innovative Versorgungsmodelle, wie das Beispiel "wohlbedacht" in München, das durch Wohngruppen und Tagespflege Entlastung für Pflegende Angehörige bietet.
Hoffnung aus der Forschung: Therapie und Heilung?
Zum Abschluss blickt Hirschhausen auf den aktuellen Stand der Wissenschaft: Lässt sich Demenz heilen? Er trifft Betroffene, die neue, ursächlich wirkende Medikamente erhalten, wie etwa das in Europa neu zugelassene Alzheimer-Medikament "Lecanemab", das schädliche Plaques im Gehirn entfernt. Auch neue, vielversprechende Forschungsansätze, wie die Gehirn-Stimulation mittels einer Therapiebrille mit 40 Hertz Gammawellen am MIT in Boston/USA, werden beleuchtet. Die Dokumentation liefert damit nicht nur Aufklärung und emotionale Einblicke, sondern auch einen dringend benötigten Hoffnungsschimmer aus der Forschung.